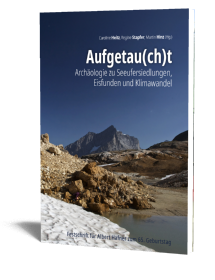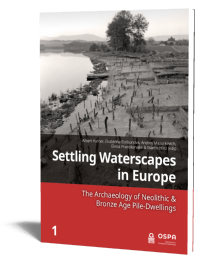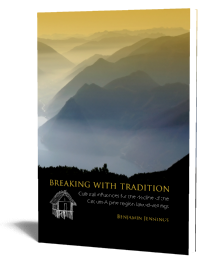Die Pfahlbaufrage
Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zur Rekonstruktion von Feuchtbodensiedlungen
Christian Harb | Forthcoming
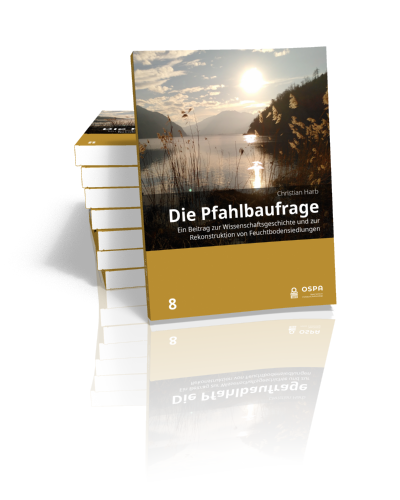
Die Pfahlbaufrage
Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zur Rekonstruktion von Feuchtbodensiedlungen
Christian Harb | Forthcoming
Paperback ISBN: 9789464281200 | Hardback ISBN: 9789464281217 | Imprint: Sidestone Press Dissertations | Format: 210x280mm | ca. 180 pp. | Open Series in Prehistoric Archaeology 8 | Series: OSPA: Open Series in Prehistoric Archaeology | Language: German | 21 illus. (bw) | 36 illus. (fc) | Keywords: pile dwellings; pile dwelling question; wetland archaeology; prehistory; construction methods; ground level buildings; elevated buildings; environmental conditions | download cover | DOI: 10.59641/u8255xg | CC-license: CC BY-NC 4.0
Publication date: 30-04-2026
-
Digital & Online access
Digital/Online version not (yet) available
-
Buy via Sidestone (EU & UK)
Get €5.00 discount on forthcoming books by using coupon code "PRE-ORDER" in your shopping cart!
-
Buy via our Distributors (WORLD)
For non-EU or UK destinations you can buy our books via our international distributors. Although prices may vary this will ensure speedy delivery and reduction in shipping costs or import tax. But you can also order with us directly via the module above.
For UK & other International destinations
For USA/Canada & other International destinations
-
Bookinfo
Paperback ISBN: 9789464281200 | Hardback ISBN: 9789464281217 | Imprint: Sidestone Press Dissertations | Format: 210x280mm | ca. 180 pp. | Open Series in Prehistoric Archaeology 8 | Series: OSPA: Open Series in Prehistoric Archaeology | Language: German | 21 illus. (bw) | 36 illus. (fc) | Keywords: pile dwellings; pile dwelling question; wetland archaeology; prehistory; construction methods; ground level buildings; elevated buildings; environmental conditions | download cover | DOI: 10.59641/u8255xg | CC-license: CC BY-NC 4.0
Publication date: 30-04-2026

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.
Vor über 170 Jahren kam im Zusammenhang mit Auffüllarbeiten in Meilen am Zürichsee ein ganzes Pfahlfeld zum Vorschein. Ferdinand Keller interpretierte dieses als Rest einer vorrömischen Pfahlbausiedlung und setzte damit die urgeschichtliche Pfahlbauforschung in Gang. Heute gelten die prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen als die wichtigste Quelle zum Verständnis des Neolithikums und der Bronzezeit in dieser Region und sind deshalb seit 2011 Teil des UNESCO-Welterbes. Allerdings ist ihre Erforschung nicht einvernehmlich verlaufen. Lebten die Menschen damals am oder über dem Wasser? Errichteten sie ihre Gebäude im Wasser, auf dem Land oder auf wechselfeuchtem Untergrund? Diese sogenannte «Pfahlbaufrage» wurde so kontrovers diskutiert, dass sie phasenweise zum Pfahlbaustreit eskalierte. Wiederholt wurde er zwischen Archäologen und Naturwissenschaftlern ausgetragen, war phasenweise Stellvertreterkrieg persönlicher Rivalen und geriet in den 1930er- und 1940er-Jahren zwischen die ideologischen Fronten. Dabei spielte die mangelnde Emanzipation von dominanten Forscherpersönlichkeiten keine unbedeutende Rolle und bis in die jüngste Zeit werden Interpretationen immer wieder an vorgefasste Meinungen angepasst.
Das vorliegende Werk zeichnet die über 170-jährige Forschungsgeschichte und die Entwicklung der Debatte nach. Dabei zeigt sich, dass einige auch heute noch etablierte Vorstellungen dringend zu hinterfragen sind, so etwa das Postulat ebenerdiger Ufersiedlungen bei guter organischer Erhaltung oder ein grosser Einfluss des Klimas auf Seepegelschwankungen.
Im Anschluss daran bietet das Werk einen Überblick über wichtige Indikatoren zur Interpretation von Feuchtbodensiedlungen, diskutiert diese im Detail und eignet sich so als Einstieg in die Problematik der Pfahlbaufrage. Schliesslich folgen Empfehlungen für künftige Grabungen und Auswertungen. Als Interpretationsgrundlage werden fünf Szenarien vorgeschlagen, die eine ebenerdige oder abgehobene Bauweise auf weitgehend trockenem (Szenario A–B) oder ausnahmsweise, saisonal oder ganzjährig überflutetem Boden (Szenarien C–E) kombinieren.
Um Antworten auf die komplexe Pfahlbaufrage zu finden, bedarf es einer differenzierten Betrachtung, die die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Ortes berücksichtigt. Dabei ist die Zusammenarbeit von Archäologie und Naturwissenschaften unabdingbar. Eindimensionale Erklärungen und einfache Modelle werden der Realität der prähistorischen Gesellschaften nicht annähernd gerecht.
English abstract
Over 170 years ago, an entire pile field came to light in connection with backfilling work in Meilen on Lake Zurich. Ferdinand Keller interpreted this as the remains of a pre-Roman pile-dwelling settlement and thus set prehistoric pile-dwelling research in motion. Today, the prehistoric pile dwellings around the Alps are considered the most important source for understanding the Neolithic and Bronze Age in this region and have therefore been a UNESCO World Heritage Site since 2011. However, their exploration has not been unanimous. Did people live on or above the water? Did they erect their buildings in the water, on land or on alternating wet ground? This so-called ‘pile-dwelling question’ (Pfahlbaufrage) was so controversial that it escalated into a pile-dwelling dispute (Pfahlbaustreit). It was repeatedly fought out between archaeologists and natural scientists, was at times a proxy war between personal rivals and in the 1930s and 1940s became caught between ideological fronts. The lack of emancipation from dominant research personalities played no insignificant role in this, and interpretations have been repeatedly adapted to preconceived opinions right up to the present day.
This book traces the 170-year history of research and the development of the debate. It shows that some ideas that are still established today urgently need to be questioned, such as the postulate of ground-level lakeshore settlements with good organic preservation or a major influence of the climate on lake level fluctuations.
The work then provides an overview of important indicators for the interpretation of wetland settlements, discusses these in detail and is thus suitable as an introduction to the problem of pile dwelling construction. Finally, recommendations for future excavations and analyses are given. Five scenarios are proposed as a basis for interpretation, combining ground-level or raised construction on largely dry ground (scenarios A–B) or exceptionally, seasonally or year-round flooded ground (scenarios C–E).
Finding answers to the complex question of pile dwelling construction requires a differentiated approach that takes into account the specific circumstances of each location. The co-operation of archaeology and natural sciences is indispensable. One-dimensional explanations and simple models do not come close to doing justice to the reality of prehistoric societies.
Vorwort und Dank
1 Einleitung
1.1 Die Bedeutung der Pfahlbaufrage
1.2 Ziel der Arbeit und Vorgehen
2 Das 19. Jh.: Die Pfahlbautheorie von Ferdinand Keller
2.1 Entdeckung der Pfahlbauten
2.2 Packwerkbauten und die Weiterentwicklung der Pfahlbautheorie
2.3 Ferdinand Keller, eine anerkannte Fachperson
3 Die 1920er- und 1930er-Jahre: Von der Pfahlbautheorie zum Pfahlbaustreit
3.1 Der Pfahlbaustreit in Deutschland
3.1.1 Neue Disziplinen und Modelle
3.1.2 Zwischenspiel Reinerth vs. Staudacher
3.2 Reaktionen aus der Schweiz
3.3 Schützenhilfe für die Pfahlbauten mit neuen Argumenten
3.4 Der «Pfahlbaustreit» der 1920er-/30er-Jahre aus heutiger Sicht
4 Die 1940er- und 1950er-Jahre: Die Pfahlbauten ziehen an Land
4.1 Der Nachruf von Oscar Paret
4.1.1 Der Mensch ist kein «Sumpftier»
4.1.2 Entrüstung in der Schweiz
4.2 Emil Vogt: Ein Todesstoss für die Pfahlbautheorie?
4.2.1 Der Pfahlbaustreit in der Tagespresse und die Argumentation Vogts
4.2.2 Kaum beachtet: Lüdis naturwissenschaftliche Gegenargumente
4.2.3 Vogts Argumentation aus heutiger Sicht
4.3 Vorgefasste Meinungen
5 Die 1960er- und 1970er-Jahre: Neue Untersuchungen an grossen Seen
5.1 Grabungen am Neuenburgersee
5.2 Grabungen am Bielersee
5.3 Grabungen am Zürichsee
5.4 Pattsituation zwischen Naturwissenschaftlern und Archäologen
6 Die 1970er- und 1980er-Jahre: Die Argumentation in Deutschland und Frankreich
6.1 Die Renaissance der Feuchtbodenarchäologie in Oberschwaben und am Bodensee
6.2 Die Feuchtbodenarchäologie im französischen Jura
6.3 Eine Vielfalt an Bauweisen
7 Die 1990er-Jahre: Das Klima nimmt Einfluss
7.1 Das Klima und das Flood-and-resettle-Modell
7.2 Kritik an den Arbeiten von Magny
7.3 Kritik am Flood-and-resettle-Modell
7.3.1 Klima: Eine komplexe Angelegenheit
7.3.2 Zur Frage von Siedlungshinweisen an höher gelegenen Stellen
7.4 Ein nuancierter Zugang
7.5 Vielfältige Gründe für Siedlungslücken
8 Die 2010er-Jahre: Pfahlbaufrage reloaded
8.1 Das Verebben der Diskussion im Kanton Zürich
8.2 Die Untersuchungen in Zürich-Parkhaus Opéra
8.2.1 Die Siedlungen heben ab
8.2.2 Repliken: Ein Rückzugsgefecht
8.3 Zurück zu Ferdinand Keller?
9 Menschliche Faktoren
9.1 Pfahlbaustreit: Keine reine Fachdiskussion
9.1.1 Kulturpolitischer Machtkampf
9.1.2 Hinterfragen von Lehrmeinungen
9.2 Mangelndes Vorstellungsvermögen
10 Indikatoren zur Beantwortung der Pfahlbaufrage
10.1 Grundsätzliche Überlegungen und Voraussetzungen
10.1.1 Eine differenzierte Betrachtungsweise
10.1.2 Zur Sedimentation von Seekreide und zu wechselnden Lagen mit Kulturschichten
10.2 Detailbetrachtungen
10.2.1.1 Gründe für Seepegelschwankungen
10.2.1.2 Untersuchungen am Neuenburgersee
10.2.1.3 Untersuchungen am Zürichsee
10.2.1.4 Veränderungen der Schichtkoten
10.2.2 Befunde
10.2.2.1 Aufgehende Konstruktionselemente
10.2.2.2 Bodenkonstruktionen aus Holz und Lehm
10.2.2.3 Bodenkonstruktionen aus Rinde
10.2.2.4 Lehmstellen und Abfallhaufen
10.2.2.5 Kulturschicht unter Lehmen und die Frage eines Bau-, Installations- oder
10.2.2.6 Schichtbildungsbedingungen
10.2.2.7 Begehung und Trittspuren
10.2.3 Schichtinhalte
10.2.3.1 Trocken- und Wasserzeiger
10.2.3.2 Verlandungserscheinungen
10.2.3.3 Hinweise auf Wellenwirkung
10.2.3.4 Erhaltungsqualität von Schichtkomponenten
10.2.4 Schichtbildung und Schichterhaltung
11 Schlussfolgerungen: 170 Jahre und ein bisschen weiser
11.1 Archäologie und Naturwissenschaften: Zwischen Kooperation und Konfrontation
11.1.1 Die Zusammenarbeit im Rückblick
11.1.2 Die Zusammenarbeit als Ausblick
11.2 Hinterfragen von etablierten Vorstellungen
11.3 Widersprüche bei ebenerdigen Ufersiedlungen mit guter Schichterhaltung
11.4 «Lost in space?» – Empfehlungen
11.4.1 Umgang mit den Indikatoren
11.4.2 Weitere Grundlagenforschung
11.5 Schlusswort
12 Zusammenfassung/Résumé/Summary
12.1 Zusammenfassung
12.2 Résumé
12.3 Summary
13 Bibliografie
14 Verzeichnisse
14.1 Abbildungsverzeichnis
14.2 Allgemeine Abkürzungen
14.3 Abkürzungen von Institutionen und Zeitschriften

Dr. Christian Harb
After completing his masters degree in cultural engineering at ETH Zurich, Christian Harb studied prehistoric archaeology at the University of Zurich (Switzerland). His dissertation at the Institute of Archaeological Sciences at the University of Bern (Switzerland) on the pile-dwelling question resulted from his main concern of interdisciplinary cooperation and his many years of work in wetland archaeology in various cantons of Switzerland. Harb coordinated the work of the UNESCO World Heritage ‘Prehistoric Pile Dwellings around the Alps’, led major evaluations such as Zurich-Parkhaus Opéra or Cham-Eslen (Zug) and carried out various excavations in pile dwellings. He is currently a research assistant at the Lucerne Cantonal Archaeological Service and is also responsible for the archaeology in the cantons of Nidwalden and Obwalden in central Switzerland.
Abstract:
Vor über 170 Jahren kam im Zusammenhang mit Auffüllarbeiten in Meilen am Zürichsee ein ganzes Pfahlfeld zum Vorschein. Ferdinand Keller interpretierte dieses als Rest einer vorrömischen Pfahlbausiedlung und setzte damit die urgeschichtliche Pfahlbauforschung in Gang. Heute gelten die prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen als die wichtigste Quelle zum Verständnis des Neolithikums und der Bronzezeit in dieser Region und sind deshalb seit 2011 Teil des UNESCO-Welterbes. Allerdings ist ihre Erforschung nicht einvernehmlich verlaufen. Lebten die Menschen damals am oder über dem Wasser? Errichteten sie ihre Gebäude im Wasser, auf dem Land oder auf wechselfeuchtem Untergrund? Diese sogenannte «Pfahlbaufrage» wurde so kontrovers diskutiert, dass sie phasenweise zum Pfahlbaustreit eskalierte. Wiederholt wurde er zwischen Archäologen und Naturwissenschaftlern ausgetragen, war phasenweise Stellvertreterkrieg persönlicher Rivalen und geriet in den 1930er- und 1940er-Jahren zwischen die ideologischen Fronten. Dabei spielte die mangelnde Emanzipation von dominanten Forscherpersönlichkeiten keine unbedeutende Rolle und bis in die jüngste Zeit werden Interpretationen immer wieder an vorgefasste Meinungen angepasst.
Das vorliegende Werk zeichnet die über 170-jährige Forschungsgeschichte und die Entwicklung der Debatte nach. Dabei zeigt sich, dass einige auch heute noch etablierte Vorstellungen dringend zu hinterfragen sind, so etwa das Postulat ebenerdiger Ufersiedlungen bei guter organischer Erhaltung oder ein grosser Einfluss des Klimas auf Seepegelschwankungen.
Im Anschluss daran bietet das Werk einen Überblick über wichtige Indikatoren zur Interpretation von Feuchtbodensiedlungen, diskutiert diese im Detail und eignet sich so als Einstieg in die Problematik der Pfahlbaufrage. Schliesslich folgen Empfehlungen für künftige Grabungen und Auswertungen. Als Interpretationsgrundlage werden fünf Szenarien vorgeschlagen, die eine ebenerdige oder abgehobene Bauweise auf weitgehend trockenem (Szenario A–B) oder ausnahmsweise, saisonal oder ganzjährig überflutetem Boden (Szenarien C–E) kombinieren.
Um Antworten auf die komplexe Pfahlbaufrage zu finden, bedarf es einer differenzierten Betrachtung, die die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Ortes berücksichtigt. Dabei ist die Zusammenarbeit von Archäologie und Naturwissenschaften unabdingbar. Eindimensionale Erklärungen und einfache Modelle werden der Realität der prähistorischen Gesellschaften nicht annähernd gerecht.
English abstract
Over 170 years ago, an entire pile field came to light in connection with backfilling work in Meilen on Lake Zurich. Ferdinand Keller interpreted this as the remains of a pre-Roman pile-dwelling settlement and thus set prehistoric pile-dwelling research in motion. Today, the prehistoric pile dwellings around the Alps are considered the most important source for understanding the Neolithic and Bronze Age in this region and have therefore been a UNESCO World Heritage Site since 2011. However, their exploration has not been unanimous. Did people live on or above the water? Did they erect their buildings in the water, on land or on alternating wet ground? This so-called ‘pile-dwelling question’ (Pfahlbaufrage) was so controversial that it escalated into a pile-dwelling dispute (Pfahlbaustreit). It was repeatedly fought out between archaeologists and natural scientists, was at times a proxy war between personal rivals and in the 1930s and 1940s became caught between ideological fronts. The lack of emancipation from dominant research personalities played no insignificant role in this, and interpretations have been repeatedly adapted to preconceived opinions right up to the present day.
This book traces the 170-year history of research and the development of the debate. It shows that some ideas that are still established today urgently need to be questioned, such as the postulate of ground-level lakeshore settlements with good organic preservation or a major influence of the climate on lake level fluctuations.
The work then provides an overview of important indicators for the interpretation of wetland settlements, discusses these in detail and is thus suitable as an introduction to the problem of pile dwelling construction. Finally, recommendations for future excavations and analyses are given. Five scenarios are proposed as a basis for interpretation, combining ground-level or raised construction on largely dry ground (scenarios A–B) or exceptionally, seasonally or year-round flooded ground (scenarios C–E).
Finding answers to the complex question of pile dwelling construction requires a differentiated approach that takes into account the specific circumstances of each location. The co-operation of archaeology and natural sciences is indispensable. One-dimensional explanations and simple models do not come close to doing justice to the reality of prehistoric societies.
Contents
Vorwort und Dank
1 Einleitung
1.1 Die Bedeutung der Pfahlbaufrage
1.2 Ziel der Arbeit und Vorgehen
2 Das 19. Jh.: Die Pfahlbautheorie von Ferdinand Keller
2.1 Entdeckung der Pfahlbauten
2.2 Packwerkbauten und die Weiterentwicklung der Pfahlbautheorie
2.3 Ferdinand Keller, eine anerkannte Fachperson
3 Die 1920er- und 1930er-Jahre: Von der Pfahlbautheorie zum Pfahlbaustreit
3.1 Der Pfahlbaustreit in Deutschland
3.1.1 Neue Disziplinen und Modelle
3.1.2 Zwischenspiel Reinerth vs. Staudacher
3.2 Reaktionen aus der Schweiz
3.3 Schützenhilfe für die Pfahlbauten mit neuen Argumenten
3.4 Der «Pfahlbaustreit» der 1920er-/30er-Jahre aus heutiger Sicht
4 Die 1940er- und 1950er-Jahre: Die Pfahlbauten ziehen an Land
4.1 Der Nachruf von Oscar Paret
4.1.1 Der Mensch ist kein «Sumpftier»
4.1.2 Entrüstung in der Schweiz
4.2 Emil Vogt: Ein Todesstoss für die Pfahlbautheorie?
4.2.1 Der Pfahlbaustreit in der Tagespresse und die Argumentation Vogts
4.2.2 Kaum beachtet: Lüdis naturwissenschaftliche Gegenargumente
4.2.3 Vogts Argumentation aus heutiger Sicht
4.3 Vorgefasste Meinungen
5 Die 1960er- und 1970er-Jahre: Neue Untersuchungen an grossen Seen
5.1 Grabungen am Neuenburgersee
5.2 Grabungen am Bielersee
5.3 Grabungen am Zürichsee
5.4 Pattsituation zwischen Naturwissenschaftlern und Archäologen
6 Die 1970er- und 1980er-Jahre: Die Argumentation in Deutschland und Frankreich
6.1 Die Renaissance der Feuchtbodenarchäologie in Oberschwaben und am Bodensee
6.2 Die Feuchtbodenarchäologie im französischen Jura
6.3 Eine Vielfalt an Bauweisen
7 Die 1990er-Jahre: Das Klima nimmt Einfluss
7.1 Das Klima und das Flood-and-resettle-Modell
7.2 Kritik an den Arbeiten von Magny
7.3 Kritik am Flood-and-resettle-Modell
7.3.1 Klima: Eine komplexe Angelegenheit
7.3.2 Zur Frage von Siedlungshinweisen an höher gelegenen Stellen
7.4 Ein nuancierter Zugang
7.5 Vielfältige Gründe für Siedlungslücken
8 Die 2010er-Jahre: Pfahlbaufrage reloaded
8.1 Das Verebben der Diskussion im Kanton Zürich
8.2 Die Untersuchungen in Zürich-Parkhaus Opéra
8.2.1 Die Siedlungen heben ab
8.2.2 Repliken: Ein Rückzugsgefecht
8.3 Zurück zu Ferdinand Keller?
9 Menschliche Faktoren
9.1 Pfahlbaustreit: Keine reine Fachdiskussion
9.1.1 Kulturpolitischer Machtkampf
9.1.2 Hinterfragen von Lehrmeinungen
9.2 Mangelndes Vorstellungsvermögen
10 Indikatoren zur Beantwortung der Pfahlbaufrage
10.1 Grundsätzliche Überlegungen und Voraussetzungen
10.1.1 Eine differenzierte Betrachtungsweise
10.1.2 Zur Sedimentation von Seekreide und zu wechselnden Lagen mit Kulturschichten
10.2 Detailbetrachtungen
10.2.1.1 Gründe für Seepegelschwankungen
10.2.1.2 Untersuchungen am Neuenburgersee
10.2.1.3 Untersuchungen am Zürichsee
10.2.1.4 Veränderungen der Schichtkoten
10.2.2 Befunde
10.2.2.1 Aufgehende Konstruktionselemente
10.2.2.2 Bodenkonstruktionen aus Holz und Lehm
10.2.2.3 Bodenkonstruktionen aus Rinde
10.2.2.4 Lehmstellen und Abfallhaufen
10.2.2.5 Kulturschicht unter Lehmen und die Frage eines Bau-, Installations- oder
10.2.2.6 Schichtbildungsbedingungen
10.2.2.7 Begehung und Trittspuren
10.2.3 Schichtinhalte
10.2.3.1 Trocken- und Wasserzeiger
10.2.3.2 Verlandungserscheinungen
10.2.3.3 Hinweise auf Wellenwirkung
10.2.3.4 Erhaltungsqualität von Schichtkomponenten
10.2.4 Schichtbildung und Schichterhaltung
11 Schlussfolgerungen: 170 Jahre und ein bisschen weiser
11.1 Archäologie und Naturwissenschaften: Zwischen Kooperation und Konfrontation
11.1.1 Die Zusammenarbeit im Rückblick
11.1.2 Die Zusammenarbeit als Ausblick
11.2 Hinterfragen von etablierten Vorstellungen
11.3 Widersprüche bei ebenerdigen Ufersiedlungen mit guter Schichterhaltung
11.4 «Lost in space?» – Empfehlungen
11.4.1 Umgang mit den Indikatoren
11.4.2 Weitere Grundlagenforschung
11.5 Schlusswort
12 Zusammenfassung/Résumé/Summary
12.1 Zusammenfassung
12.2 Résumé
12.3 Summary
13 Bibliografie
14 Verzeichnisse
14.1 Abbildungsverzeichnis
14.2 Allgemeine Abkürzungen
14.3 Abkürzungen von Institutionen und Zeitschriften

Dr. Christian Harb
After completing his masters degree in cultural engineering at ETH Zurich, Christian Harb studied prehistoric archaeology at the University of Zurich (Switzerland). His dissertation at the Institute of Archaeological Sciences at the University of Bern (Switzerland) on the pile-dwelling question resulted from his main concern of interdisciplinary cooperation and his many years of work in wetland archaeology in various cantons of Switzerland. Harb coordinated the work of the UNESCO World Heritage ‘Prehistoric Pile Dwellings around the Alps’, led major evaluations such as Zurich-Parkhaus Opéra or Cham-Eslen (Zug) and carried out various excavations in pile dwellings. He is currently a research assistant at the Lucerne Cantonal Archaeological Service and is also responsible for the archaeology in the cantons of Nidwalden and Obwalden in central Switzerland.
-
Digital & Online access
Digital/Online version not (yet) available
-
Buy via Sidestone (EU & UK)
Get €5.00 discount on forthcoming books by using coupon code "PRE-ORDER" in your shopping cart!
-
Buy via our Distributors (WORLD)
For non-EU or UK destinations you can buy our books via our international distributors. Although prices may vary this will ensure speedy delivery and reduction in shipping costs or import tax. But you can also order with us directly via the module above.
For UK & other International destinations
For USA/Canada & other International destinations
- Browse all books by subject
-
Search all books

We will plant a tree for each order containing a paperback or hardback book via OneTreePlanted.org.
You might also like:
© 2026 Sidestone Press KvK nr. 28114891 Privacy policy Sidestone Newsletter Terms and Conditions (Dutch)